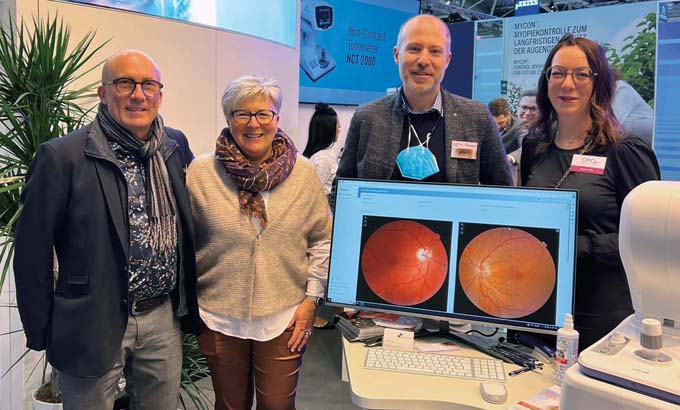Der Schweizer Berufsverband für Augenoptiker und Optometristen passt sich der Zeit an
Am 16. und 17. März fand im inspirierenden Ambiente des Paul Klee Zentrums die diesjährige SBAO-Fachtagung statt.

Die diesjährige Tagung bot ein vielfältiges Programm mit hochkarätigen Vorträgen in Französisch, Englisch und Deutsch zu Linsen, Screeningmethoden und aktuellen Forschungsergebnissen. Besonders wertvoll waren die praxisnahen Fallbeispiele von Fachexperten aus den Bereichen Kontaktlinsenanpassung und Binokularsehen. Ein Industriepanel rundete die Veranstaltung mit einer Perspektive Richtung Zukunft ab.
Werden Augenoperationen in Zukunft von Robotern durchgeführt?
Die Kriterien für den optimalen Zeitpunkt einer Kataraktoperation sind nicht eindeutig definiert. Martin Kündig betonte in seinem Vortrag, dass Patienten die Auswirkungen der Behandlung besser akzeptieren, wenn die Operation nicht zu früh durchgeführt wird.
Das Wohlergehen der Patienten sei bei Eingriffen wichtiger als das Ego des Arztes. In ihrer Präsentation zur Glaukombehandlung äusserte Dr. Ségolèene Roemer ihre Überzeugung, dass eine erfolgreiche Behandlung auf einer guten interdisziplinären Kooperation basiere. Sie unterstrich dabei besonders die Zusammenarbeit der Ophtalmologen und der Optometristen.
Prof. Dr. Matthias Becker, Begründer der Ophthorobotics AG, hat zusammen mit der ETH Zürich die Möglichkeiten erforscht, wie Roboter bei Augenoperationen helfen könnten. Heute hätten die Chirurgen selbst immer noch die volle Kontrolle über die Operationen. Einzig die Telerobotik findet schon Anwendung, unter anderem bei der Lasik. Bei Operationen an der Vorderseite des Auges sind die manuellen Operationsmethoden so gut entwickelt, dass sie nach wie vor der Robotik vorgezogen werden. Das liegt unter anderem daran, dass die heutigen Roboter noch zu grob für das empfindliche Auge sind. Eine interessante Ausnahme wäre hier einzig die Injektionsrobotik. Maschinelle Injektionssysteme könnten es ermöglichen, mehrere Patienten gleichzeitig zu behandeln. Ein bedeutender Vorteil von Robotern ist ihre absolute Bewegungsstabilität. Da selbst erfahrenste Chirurgen ein natürliches Handzittern aufweisen, wurden bereits spezielle Hilfsinstrumente entwickelt, die dieses Zittern ausgleichen und völlige Bewegungslosigkeit gewährleisten. Während der Operation steuert der Chirurg den Roboterarm – die rechte Hand für die rechte Seite, die linke Hand für die linke Seite, während die Pinzette per Fusssteuerung bedient wird. Diese innovative Technik ermöglicht es den Ärzten, auch schwer zugängliche Bereiche im Auge zu behandeln und die eigene Position zu verändern, während das Operationswerkzeug präzise und stabil im Auge verbleibt.

Auf die Frage nach ihren Zukunftsträumen äusserten die anwesenden Industriepartner der OSO auf der Bühne ihre Ideen. Vorne mit dabei waren digitale KI gesteuerten Brillengläser und Kontaktlinsen aber auch eine Brillenputz- und Padwechselmaschine war mit dabei. Anwesend waren v.r.n.l. Stephan Kettler von der Firma Zeiss, Patrica Dallinger von der Firma Alcon, Enrico Giarrusso von Optiswiss AG, Mischa Wolf von CooperVision, Yves Bargetzi, Rodenstock, Samuel Schaub von Hoya, von der Firma Essilor Marc von der Burg. Geleitet wurde die Runde durch den Präsidenten des SBAO Manuel Kovats, ganz rechts.
Sklerallinse
Der Montagmorgen der Tagung stand ganz unter dem Stern der Sklerallinse. Im ersten Vortrag, behandelte Alex Ziörjen die möglichen Troubleshootings beim Anpassen dieser grossen Linsen. Vieles stehe und falle mit dem Pflegemittel, so der Redner. Bei geröteten Augen oder Unverträglichkeiten wechsle er sicher erst einmal das Aufbewahrungsmittel. Bei Problemen mit dem Sitz wechselt der Anpasser dann auch gerne mal auf eine Freeformlinse und löst damit viele der Sitzprobleme. Wichtig sei es aber, dass man immer im Blick habe, dass Visus 1.0 nicht immer bedeute, dass der Kunde auch wirklich 1.0 scharf sehe. Oft könne man eine Öffnung bei einem Sehzeichen auch in Unschärfe raten.
Vor einigen Jahren sei Sklerallinsenspezialist Brian Tompkins als Redner an einer Fachtagung mit einer Harley Davidson auf die Bühne gefahren. Als Hommage an seinen Folgeredner kam Philippe Seira an der aktuellen Tagung mit einem Trottinett auf die Bühne. In seinem Vortrag verglich er verschiedene Kochrezepte für Linsen miteinander und demonstrierte so die unterschiedlichen Möglichkeiten auch bei der Kontaktlinsenanpassung. Sein Vortrag stand unter dem Schwerpunkt des Kampfes gegen die Drop-outs. Mündliche und schriftliche Informationen seien essenziell, um den Kunden gut aufzuklären und zu begleiten. In ihrer Praxis hätten sie zu diesem Zweck viele Informationsprospekte aufliegen. Die meisten davon sind von ihnen selbst entwickelt und mit erklärenden Fotos und Zeichnungen versehen. Die Optometristen seien dazu in der Lage, den Menschen die Freude am Linsentragen zu vermitteln. Nachkontrollen sollten wie die Kirche wieder mitten im Dorf stehen, so der Waadtländer. Eine Nachkontrolle sollte kosten, sie sollte aber auch dafür genutzt werden, Professionalität zu zeigen, über Neuheiten zu informieren und für eine gute Kundenbindung zu sorgen.
Brian Tompkins aus Grossbritannien nennt sich Optometrist Entertainer und lebt das voll aus. Für ihn sind alle Anpasser Superhelden und sollten sich auf ihre Superkraft besinnen. Weil man als Optometrist und Linsenanpasser die Leute nicht spüren und keine Gedanken lesen könne, müsse man zum Superdetektiv werden. Wichtig sei es, gut hinzuhören und zwischen den Zeilen zu lesen. Auch er empfiehlt Fragebögen, vor allem soll auf die unausgesprochenen Ängste der Kunden geachtet werden. In ihrer Praxis hat Brian und sein Super-Optometrist-Team ein Abosystem eingeführt. Er nannte es «Netflixsystem». Sie führen Abos für verschiedene Linsen und Bedürfnisse und alle haben alles inklusive. Die Kunden müssen für nichts dazu bezahlen. Sein Statement war: Umarme deine Superkraft, fliege zu deiner Klinik und sei entflammt. Und mach es mit Sparkle und freue dich. Hab Spass.
Rotes oder blaues Licht zur Myopiekontrolle
Prof. Dr. Dr. Frank Schaeffel, ein Biophysiker vom Universitätsklinikum Tübingen und IOP Basel, hat wichtige Erkenntnisse zur Myopiekontrolle vorgestellt. Seine Forschungen konzentrieren sich auf die Wirkung verschiedenfarbiger Lichtquellen auf die Entwicklung der Kurzsichtigkeit. Schon länger wurde festgestellt, dass aktives Draussensein die Myopieentwicklung stärker hemmen kann als genetische Faktoren. In Studien wurde verglichen, wie sich Tageslichtlampen und natürliches Aussenlicht auswirken. Die besten Ergebnisse wurden bei einer Lichtintensität von 20.000 Lux erzielt, wobei es keinen Unterschied machte, ob das Licht künstlich oder natürlich war. 20 000 Lux entspricht Tageslicht ohne direkte Sonneneinstrahlung. Interessanterweise sind UV-Therapien, die bei manchen Tieren erfolgreich sind, beim Menschen nicht wirksam, da UV-Licht die Netzhaut gar nicht erreicht. Besonders aufschlussreich war ein Experiment mit Hühnern: Diese entwickelten nämlich trotz Aussenaufenthalt eine Kurzsichtigkeit, wenn sie Dopaminblocker erhielten. Dies zeigt deutlich, dass nicht die Bildschärfe allein ausschlaggebend ist, sondern dass das Zusammenspiel von Dopamin und Melanin eine zentrale Rolle spielt. Die Forschung deutet darauf hin, dass verschiedene Lichtfarben unterschiedliche Reaktionen hervorrufen und möglicherweise eine Kombination verschiedener Farben notwendig ist, um eine berechenbare Reaktion im Auge auszulösen.
Die Fachtagung bot eine gelungene Mischung aus Wissenschaft, Praxisnähe und Inspiration – und unterstrich einmal mehr die Bedeutung des interdisziplinären Austauschs in der modernen Augenoptik.
Die nächsten Tagungen des OSO sind die ganz neu ins Leben gerufenen Kongresse der Romandie am 18. Mai in Alpha Palmiers, Lausanne und des Tessins in Bellinzona am 12. Oktober. Die OPTX findet auch dieses Jahr wieder in Baden statt, und zwar am 21. September, und für die nächste Frühlings-Tagung heisst es: «Tschüss und auf Wiedersehen im nächsten Jahr, im Zentrum Paul Klee in Bern.»